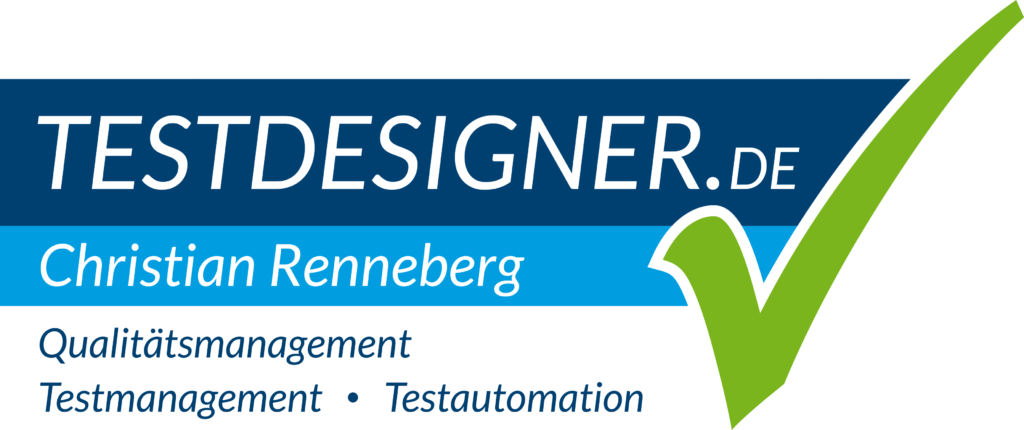Konkrete Anforderungen des BFSG an die Web-Barrierefreiheit
Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) verpflichtet viele Unternehmen, ihre Websites und Apps bis 28. Juni 2025 barrierefrei zu gestalten[1] [2]. „Barrierefrei“ bedeutet hier die Einhaltung konkreter technischer Standards. Insbesondere verweist das BFSG auf die europäische Norm EN 301 549, die für Websites die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 auf Level AA vorschreibt[1] [3]. Praktisch werden die WCAG 2.1 Level AA damit zum gesetzlichen Maßstab für Barrierefreiheit von privaten Websites[1] [3]. Eine Website, die den WCAG-2.1-AA-Kriterien entspricht, gilt gemäß BFSG als barrierefrei (sog. Konformitätsvermutung nach § 4 BFSG)[1] [3]. Die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) für öffentliche Stellen basiert ebenfalls auf EN 301 549/WCAG und setzt ähnliche Anforderungen[4]– die Vorgaben für private Anbieter unterscheiden sich also kaum.
Konkret müssen Webseiten damit u. a. folgende Anforderungen erfüllen[3] [3]:
- Wahrnehmbarkeit: Bereitstellung von Textalternativen (Alt-Texte) für Bilder und Grafiken sowie Untertiteln/Transkripten für Videos und Audio[3]. Inhalte sollen in klar lesbarer Schrift mit ausreichendem Farbkontrast präsentiert werden[3]. Auf rein durch Farben oder Audio vermittelte Informationen ist zu verzichten bzw. Alternativen sind bereitzustellen.
- Bedienbarkeit: Alle Funktionen müssen vollständig tastaturbedienbar sein – die Seite darf nicht voraussetzen, dass man eine Maus benutzt[3]. Interaktive Elemente (Links, Buttons, Formulare) sollen ausreichend groß und eindeutig benannt sein. Die Navigation muss intuitiv, konsistent und zugänglich sein (z. B. durch klare Menüs, sichtbare Fokusmarkierungen und Sprunglinks zum Überspringen von Bereichen)[3]. Dynamische Inhalte (wie Slideshows) sollen steuerbar sein, und zeitgesteuerte Abläufe (z. B. automatische Logouts oder Banner) dürfen Nutzer nicht unter unnötigen Zeitdruck setzen[3].
- Verständlichkeit: Inhalte und Strukturen der Seite sollen logisch und verständlich aufgebaut sein. Eine korrekte Überschriften-Hierarchie, geordnete Listen und verständliche Linktexte helfen allen Nutzern bei der Orientierung[3]. Formulare brauchen klare Labels und verständliche Fehlermeldungen. Leicht verständliche Sprache sowie Erläuterungen von Abkürzungen und Fachbegriffen erhöhen die Zugänglichkeit für Menschen mit kognitiven Einschränkungen.
- Robustheit: Die Website muss technisch so umgesetzt sein, dass sie mit unterschiedlichen Browsern, Endgeräten und assistiven Technologien (wie Screenreadern) zuverlässig funktioniert. Sauberer HTML-Code, ARIA-Rollen zur semantischen Auszeichnung von Bereichen und Kompatibilität mit aktuellen Standards sichern diese Robustheit.
Zusätzlich schreibt das BFSG für betroffene Websites eine Erklärung zur Barrierefreiheit vor[4]. Diese muss leicht auffindbar (z. B. im Footer neben Impressum/Datenschutz) und selbst barrierefrei sein[1]. In der Erklärung gibt das Unternehmen an, inwieweit die Website barrierefrei ist, welche Teile ggf. (noch) nicht barrierefrei sind und wie die Barrierefreiheit sichergestellt wird[4]. Außerdem muss eine Kontaktmöglichkeit angegeben werden, über die Nutzer Barrieren melden oder Unterstützung anfordern können[4]. Damit entsteht ähnlich wie bei öffentlichen Stellen (BITV) eine Feedback-Prozess. Schließlich fordert das Gesetz auch eine ** kontinuierliche Sicherstellung** der Barrierefreiheit: Die Anforderungen müssen auch bei künftigen Änderungen erfüllt bleiben, was fortlaufende Pflege bedeutet[5] [5].
Geltungsbeginn und betroffene Unternehmen (Größen und Branchen)
Stichtag für die Anwendung des BFSG ist der 28. Juni 2025: Ab diesem Datum müssen alle erfassten Produkte und Dienstleistungen barrierefrei sein[1] [4]. Es gibt keine generelle Schonfrist für bestehende Websites oder Online-Shops – diese müssen bis spätestens zu diesem Datum nachgerüstet sein[1] [2]. Übergangsfristen sind nur für bestimmte physische Produkte und laufende Vertragsverhältnisse vorgesehen (z. B. dürfen vor 2025 installierte Geldautomaten bis max. 15 Jahre weitergenutzt werden)[6] [1]. Für Webseiten und digitale Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr gelten jedoch keine Verlängerungen – ein Online-Shop oder Buchungsportal muss ab 28.06.2025 vollständig barrierefrei zur Verfügung stehen[1] [2].
Das Gesetz richtet sich nicht an alle Websites, sondern an bestimmte Produkte und Dienstleistungen für Verbraucher. Es setzt damit den Anwendungsbereich der EU-Richtlinie (European Accessibility Act) um. Typische betroffene Branchen und Angebote sind[6] [4]:
- E-Commerce: Alle Online-Shops und Online-Marktplätze sowie generell Dienste des elektronischen Geschäftsverkehrs, bei denen Verbraucher online Produkte oder Dienstleistungen erwerben können[4]. Dazu zählen auch kleinere Webshops und digitale Buchungssysteme (z. B. für Reisen, Veranstaltungen) sowie Bestell- und Anmeldeformulare auf Websites[4]. Selbst kostenfreie Online-Dienste können darunterfallen, wenn sie im Rahmen eines Verbrauchervertrags angeboten werden (dies wird teils diskutiert – im Zweifel sollte man auch z. B. eine Newsletter-Anmeldung barrierefrei gestalten)[3] [3].
- Finanz- und Telekommunikationsdienste: Online-Banking und Versicherungsportale, Bankdienstleistungen (z. B. Websites von Banken, Online-Bezahlsysteme) und Telefondienste/Messenger für Verbraucher[6].
- Transport und Reisen: Digitale Dienste im öffentlichen Personenverkehr (z. B. Buchungs-Apps, Ticket-Websites im Bahn- oder Flugverkehr) sowie Fahrkartenautomaten und Check-in-Terminals[6] [6].
- Medien und E-Books: Elektronische Lesegeräte und zugehörige Online-Bibliotheken oder Shops für E-Books, Streaming-Dienste etc., inklusive deren Websites/Apps[6] [6].
- Hardware und Software für Endnutzer: Zwar stehen im Vordergrund digitale Dienstleistungen, aber auch Hersteller von Verbraucher-Hardware (Smartphones, Computer, Router, Smart-TVs, etc.) müssen ab 2025 barrierefreie Produkte anbieten[6] [2]. Deren Websites (z. B. Support-Portale, Online-Produktdokumentation) dürften ebenfalls die Anforderungen erfüllen müssen, zumindest soweit sie Teil der angebotenen Dienstleistung sind.
Nicht alle Unternehmen fallen unter das BFSG. Wichtig ist vor allem die Unterscheidung nach Unternehmensgröße und Kundengruppe:
- Kleinstunternehmen (Micro-Unternehmen): Firmen mit weniger als 10 Beschäftigten und höchstens 2 Mio. € Jahresumsatz sind grundsätzlich vom BFSG ausgenommen, sofern sie ausschließlich Dienstleistungen für Verbraucher anbieten[6] [2]. Beispiel: Ein Kleinstunternehmen, das nur einen Online-Service betreibt, muss die BFSG-Pflichten nicht erfüllen. Achtung: Sobald ein Kleinstunternehmen Produkte im Sinne des Gesetzes in Verkehr bringt (z. B. eigene Hardware verkauft), greift das Gesetz auch für diese Kleinstunternehmen[6] [2]. Die Ausnahmeregel gilt also nur für reine Dienstleistungsanbieter in Micro-Größe.
- Größere KMU und Großunternehmen: Alle Unternehmen, die die Mikro-Kriterien überschreiten (≥10 Mitarbeiter und >2 Mio. € Umsatz) und die oben genannten relevanten Dienste/Produkte für Verbraucher anbieten, müssen das BFSG einhalten[1] [3]. Das betrifft in der Praxis viele mittelständische Online-Händler, SaaS-Anbieter mit Endverbrauchern, FinTechs, Reiseportale etc., genauso wie Großkonzerne im B2C-Bereich.
- Branchen- und Angebots-Ausnahmen: Private oder rein hobbymäßige Websites, die nicht kommerziell sind, fallen nicht unter das BFSG[4]. Ebenso ausdrücklich ausgenommen sind rein geschäftliche B2B-Angebote, die sich ausschließlich an professionelle Kunden/Unternehmer richten[2] [4]. Hier greift das Gesetz nicht, solange Verbraucher nicht Zielgruppe sind. (Unternehmen mit B2B-Websites sollten jedoch sicherstellen, dass wirklich keine Nutzung durch Verbraucher erfolgt, falls sie sich auf diese Ausnahme berufen möchten[2].)
- Unverhältnismäßige Belastung: Das BFSG enthält einen Passus (§ 17 BFSG), wonach ein Unternehmen einen Antrag stellen kann, von bestimmten Barriereanforderungen befreit zu werden, falls deren Erfüllung eine unverhältnismäßige Belastung darstellt[3]. Dies muss anhand definierter Kriterien begründet werden (z. B. wirtschaftliche Zumutbarkeit, Kosten-Nutzen-Verhältnis, Unternehmensgröße). Diese Ausnahme dürfte in der Praxis nur in eng begrenzten Fällen greifen – grundsätzlich ist Barrierefreiheit ab 2025 der Regelfall, den auch kleine und mittlere Unternehmen einplanen müssen.
Fazit: Für alle privatwirtschaftlichen Websites, die an Verbraucher gerichtete Dienstleistungen erbringen (insbesondere E-Commerce), gilt ab 28.06.2025 die Pflicht zur Barrierefreiheit – unabhängig von Branche, sofern keine Kleinstunternehmer-Ausnahme greift[1]. Unternehmen sollten im Zweifel eher davon ausgehen, betroffen zu sein, da das BFSG die digitale Teilhabe breit sicherstellen will. Selbst wenn eine Website formal nicht unter das Gesetz fällt, lohnt sich Barrierefreiheit: Sie verbessert die Usability und Reichweite für alle Nutzer und bringt auch SEO-Vorteile[7] [5].
Umsetzung barrierefreier Websites in der Praxis
Wie können Unternehmen nun ihre Webseiten barrierefrei gestalten? Hier sind die wichtigsten Aspekte – von der Einhaltung anerkannter Standards über die Gestaltung von Design und Inhalten bis zur technischen Umsetzung im Content-Management-System (CMS):
Einhaltung von WCAG 2.1 und BITV-Standards
Als ersten Schritt sollten sich Unternehmen an den etablierten Standards orientieren. Die internationalen WCAG 2.1 Richtlinien (Level AA) sind – wie oben beschrieben – de facto Gesetz geworden und geben detailliert vor, welche Erfolgskriterien eine barrierefreie Website erfüllen muss[3] [3]. Dazu gehören z. B. Anforderungen an Alternativtexte, Tastaturbedienbarkeit, Farbkontraste, Überschriftenstruktur, Formulare etc. (eine Auswahl wurde oben bereits dargestellt). Die BITV 2.0 enthält für Behörden-Websites ganz ähnliche Vorgaben und verweist inzwischen ebenfalls auf EN 301 549/WCAG[4]. Kurzum: Wer seine Website bereits nach WCAG 2.1 AA (oder BITV 2.0) ausgerichtet hat, ist auf das BFSG bestens vorbereitet[4].
In der Praxis empfiehlt es sich, einen WCAG-Checkliste durchzugehen oder ein BITV-Testverfahren (z. B. den BIK-BITV-Test) zur Bewertung heranzuziehen. Dabei werden rund 60 Prüfpunkte aus allen vier Prinzipien (wahrnehmbar, bedienbar, verständlich, robust) kontrolliert. Die Ergebnisse zeigen konkret, wo noch Nachbesserungen nötig sind. Viele dieser Prüfkriterien lassen sich mit geeigneten Tools und etwas Know-how umsetzen – sei es durch Entwickler, Webagenturen oder mit externer Beratung. Außerdem sollte die vorgeschriebene Barrierefreiheitserklärung erstellt und auf der Website veröffentlicht werden (siehe oben), inkl. Hinweis auf die Kontaktstelle für Feedback[4] [4].
Anforderungen an Design, Struktur und Inhalte
Für eine barrierefreie Gestaltung gelten einige bewährte Grundsätze:
- Layout und Design: Setzen Sie auf ein klar strukturiertes Layout mit gut erkennbarer Navigationsstruktur. Wiederkehrende Elemente (Menüs, Suche, Footer) sollten auf allen Seiten einheitlich angeordnet sein (konsistente Navigation)[7]. Verwenden Sie ausreichend große Schriften in einer gut lesbaren Schriftart. Hohe Farbkontraste zwischen Text und Hintergrund sind Pflicht – als Richtwert gelten mindestens 4.5:1 Kontrastverhältnis für Fließtext (WCAG 2.1 Erfolgskriterium 1.4.3). Vermeiden Sie rein farbliche Kennzeichnungen (z. B. „rote Felder sind Pflichtfelder“ – hier zusätzlich z. B. Sternchen oder Text verwenden). Blinkende oder automatisch wechselnde Inhalte sollten möglichst unterlassen oder abschaltbar gestaltet werden, da sie für manche Nutzer irritierend oder unzugänglich sind. Fokus-Indicator: Stellen Sie sicher, dass fokussierte Elemente (bei Tastaturnavigation) optisch hervorgehoben werden, sodass Tastaturnutzer immer sehen, wo sie sich befinden.
- Seitenstruktur und Navigation: Nutzen Sie HTML Überschriften-Tags (h1–h6), um die inhaltliche Struktur abzubilden. Jede Seite sollte eine logische Überschriften-Hierarchie haben, beginnend mit genau einer Hauptüberschrift (h1), gefolgt von sinnvollen Unterüberschriften[3]. Listen sollten mit <ul>/<ol> korrekt ausgezeichnet sein, Zitate mit <blockquote> etc., damit Screenreader-Nutzer die Struktur erkennen können. Die Hauptnavigation sollte als HTML-Liste mit entsprechenden Menüpunkten umgesetzt sein und idealerweise durch ARIA-Rollen (z. B. role=“navigation“) oder HTML5-<nav>-Element gekennzeichnet werden. Wichtig ist auch eine überspringbare Navigation: Bieten Sie z. B. einen „Skip to content“-Link am Seitenanfang an, damit Keyboard- und Screenreader-Nutzer nicht auf jeder Seite alle Menüpunkte durchgehen müssen. Bei mehrsprachigen Seiten sollte die Sprache im HTML-Code deklariert sein (lang-Attribut), ebenso wie Sprachwechsel innerhalb des Textes, um Screenreader die richtige Aussprache zu ermöglichen.
- Inhalte und Medien: Alle Nicht-Text-Inhalte brauchen textuelle Alternativen. Bilder müssen mit Alternativtexten (alt-Attribut) versehen sein, die ihren Informationsgehalt wiedergeben[3]. Komplexe Grafiken (z. B. Infografiken) sollten eine ausführlichere Beschreibung im Umfeld oder auf separater Seite bieten. Videos benötigen Untertitel oder Transkripte für hörbehinderte Personen[3]; bei reinen Informationsvideos kann auch eine Zusammenfassung des Inhalts als Text genügen. Audio-Inhalte sollten ebenfalls schriftlich zusammengefasst werden (sofern sie nicht bloß Hintergrundmusik sind). Achten Sie bei Texten auf verständliche Sprache: Kurze Sätze, gängige Wörter und wenn nötig Erläuterungen in Leichter Sprache oder Gebärdensprachvideos (letzteres ist für privatwirtschaftliche Sites keine Pflicht, aber für bestimmte Zielgruppen hilfreich). Formulare sind ein kritischer Inhalt: Jedes Eingabefeld benötigt ein Label, entweder via <label>-Tag verbunden oder programmgesteuert (aria-label). Die Fehlermeldungen bei falscher Eingabe sollten präzise sein und idealerweise auch vorlesen lassen (z. B. durch aria-live Regions). Ebenso sollten Formular-Steuerelemente gruppiert und mit Feldset-/Legend-Tags versehen werden, wo sinnvoll (z. B. bei Gruppen von Optionsfeldern). Für PDFs oder herunterladbare Dokumente gilt: Wenn solche dokumentartigen Inhalte Teil des Service sind, müssen sie ebenfalls barrierefrei (nach PDF/UA-Standard) bereitgestellt oder es muss zumindest eine barrierefreie Alternative angeboten werden[1].
- Interaktion und Bedienung: Alle interaktiven Funktionen müssen ohne Maus zugänglich sein – d.h. via Tastatur (typischerweise mit Tab/Enter/Leertaste zur Steuerung)[3]. Testen Sie die Website deshalb unbedingt einmal nur mit Tastatur: Kann man alle Menüs, Links und Controls erreichen? Bleibt man irgendwo „stecken“? Falls ja, muss der Fokusablauf korrigiert werden. Komplexe Widgets (z. B. Dropdown-Menüs, Tabs, Slidern) sollten ARIA-Attribute nutzen, um ihren Zustand (offen/zu, aktiv/inaktiv) mitzuteilen. Stellen Sie außerdem sicher, dass keine wichtigen Inhalte oder Hinweise rein visuell präsentiert werden, ohne Screenreader-Zugänglichkeit. Beispiele: Fehlermeldungen nur in roter Schrift ohne Text, oder Hover-Menüs, die Tastaturnutzern gar nicht erscheinen – so etwas ist zu vermeiden. Timing: Wenn es zeitgesteuerte Inhalte gibt (Slideshows, Timeout für Logins etc.), sollte der Nutzer die Kontrolle darüber haben (Pausen-Button, Verlängerungsoption)[3].
All diese Maßnahmen folgen den WCAG-Kriterien. Ihre Umsetzung macht die Website nicht nur für Menschen mit Behinderungen besser, sondern steigert generell die Usability. Barrierefreie Designs zeichnen sich oft durch eine klarere Struktur, intuitivere Navigation und weniger Fehleranfälligkeit aus – was allen Benutzern zugutekommt[7].
Praktische Umsetzung mit bestehenden Content-Management-Systemen (CMS)
Viele Unternehmens-Websites basieren auf gängigen CMS wie WordPress, Typo3, Joomla, Drupal oder proprietären Systemen. Grundsätzlich lässt sich in jedem modernen CMS eine barrierefreie Website erstellen, wenn man einige Punkte beachtet:
- Barrierefreie Themes/Templates: Wählen Sie nach Möglichkeit ein Theme oder Design-Template, das von vornherein auf Barrierefreiheit ausgelegt ist (einige CMS-Communities bieten explizit WCAG-konforme Themes an). Achten Sie z. B. darauf, dass das Template valide HTML-Strukturen nutzt, ausreichende Kontraste bietet und kompatibel mit Screenreader-Ausgaben ist. Vermeiden Sie Themes, die z. B. Menüs nur mit Hover-Effekten ohne Fokussierbarkeit versehen haben.
- Struktur im CMS nutzen: Pflegen Sie Inhalte so ein, dass die semantische Struktur erhalten bleibt. Zum Beispiel: nutzen Sie die Überschriftenformate (H1, H2, etc.) in der CMS-Textredaktion korrekt nach Hierarchie und nicht bloß für visuelle Effekte (also keine Überschrift-Stile für normalen Fettdruck zweckentfremden). Verwenden Sie Listenfunktionen des CMS für Aufzählungen, Tabellenfunktion für echte Tabellen (und nicht zum Layoutzweck), etc. Viele CMS erzeugen zugänglichen Code, wenn man ihre Inhaltsmodule richtig nutzt.
- Medien-Alternativen hinterlegen: Stellen Sie sicher, dass Redakteure zu jedem Bild im CMS einen Alternativtext eintragen – die meisten CMS bieten ein Feld dafür an, das unbedingt genutzt werden sollte. Ähnliches gilt für Videos oder Audio: falls das CMS keine eigene Lösung hat, können z. B. YouTube-Videos mit Untertiteln eingebettet werden. Ein CMS sollte die Möglichkeit bieten, Untertitel für HTML5-Videos einzubinden. Wenn Ihr CMS PDF-Dokumente verwaltet, achten Sie darauf, diese barrierefrei zu erstellen (z. B. mit Tags und Lesezeichen) bevor Sie sie hochladen.
- Formulare und Plugins: Viele Websites verwenden Plugins oder Erweiterungen (Kontaktformulare, Shop-Module, Captcha, Karten-Widgets etc.). Hier muss geprüft werden, ob diese Erweiterungen barrierefrei sind. Zum Beispiel: Ein gängiges Kontaktformular-Plugin sollte entsprechende Label-Ausgabe haben und Fehlermeldungen zugänglich machen – testen Sie das oder fragen Sie den Anbieter. Ein schwieriges Thema sind eingebettete Karten (z. B. Google Maps) oder Captchas: Diese sind oft nicht vollständig barrierefrei. Gemäß BFSG bleibt das Unternehmen trotzdem in der Verantwortung, auch bei Drittkomponenten[4]. Empfehlung: Nutzen Sie nach Möglichkeit barrierefreie Alternativen (z. B. ein einfaches Adressfeld statt einer interaktiven Karte). Wo das nicht geht, weisen Sie in der Barrierefreiheitserklärung auf die verbleibenden Barrieren hin und bieten Alternative Inhalte an – etwa die Adresse als Text und Download-Wegbeschreibung als Ersatz für die Karte[4], oder einen alternativen Kontaktweg falls jemand das Captcha nicht bedienen kann.
- Updates und Tests im Betrieb: In CMS-basierten Webseiten kommen regelmäßig Updates (Inhalte, Funktionen, Sicherheitsupdates). Barrierefreiheit muss dauerhaft sichergestellt werden, d.h. nach jedem größeren Update oder Relaunch sollte wieder geprüft werden[5] [5]. Wenn z. B. das CMS oder Theme gewechselt wird, muss die neue Version wiederum WCAG-konform sein[5]. Schulten Sie Ihre Entwickler und Redakteure dahingehend, dass Barrierefreiheit bei jedem neuen Inhalt und jeder Änderung mitgedacht wird[5]. Zum Beispiel sollten Redakteure wissen, wie man Tabellenüberschriften definiert oder warum es wichtig ist, Beschriftungen nicht leer zu lassen. Eine Schulung des verantwortlichen Web-Teams – sowohl technische Entwickler als auch Content-Verantwortliche – ist eine sinnvolle Investition, um Barrierefreiheit im täglichen Betrieb zu verankern[5].
Tipp: Dokumentieren Sie interne Guidelines für barrierefreies Webdesign und Content-Pflege in Ihrem Unternehmen. Das kann eine Checkliste für Redakteure sein (z. B. „Hat jedes Bild einen Alt-Text?“, „Sind Überschriften in richtiger Reihenfolge?“) und Vorgaben für Webentwickler oder Agenturen (z. B. „bei neuen Features auf Tastaturbedienbarkeit achten“, „Kontraste vorher prüfen“). So wird Barrierefreiheit zu einem Qualitätsstandard im gesamten Webprozess.
Fokus: Regelmäßiges und professionelles Testing
Ein zentraler Erfolgsfaktor zur Einhaltung der Barrierefreiheit ist regelmäßiges Testing der Webseiten. Nur durch fortlaufende Prüfungen – idealerweise durch geschulte Tester und reale Nutzer – kann man sicherstellen, dass die Standards tatsächlich umgesetzt sind und keine neuen Barrieren entstehen. Im Folgenden wird beleuchtet, warum Testing nötig ist, ob Unternehmen lieber interne oder externe Tester einsetzen sollten, welche Risiken ohne Testing drohen und welche Testverfahren sinnvoll sind.
Warum ist regelmäßiges Testing wichtig?
Barrierefreiheit ist kein Zustand, den man einmalig herstellt und der dann für immer garantiert ist. Websites unterliegen Änderungen: neue Inhalte, Features, Designanpassungen oder technische Updates. Jede Änderung kann unbeabsichtigt Barrierefreiheits-Probleme einführen. Regelmäßiges Testing deckt solche Probleme frühzeitig auf[5] [5]. Professionelle Tests sind nötig, weil automatisierte Prüftools allein nicht ausreichen, um alle Barrieren zu finden. Manche Fehler – etwa unklare Formulierung einer Fehlermeldung oder eine unlogische Fokus-Reihenfolge – erkennt kein Automat. Zudem zeigt nur regelmäßiges Testing, ob die Website in der Praxis für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen wirklich nutzbar ist. Kurz: Kontinuierliche Tests sind die Qualitätssicherung für digitale Barrierefreiheit und schützen Unternehmen davor, versehentlich in Rechtsverstöße hineinzugeraten, wenn z.B. eine neue Funktion nicht WCAG-konform ist.
Dabei sollte das Testing nicht erst kurz vor der gesetzlichen Deadline (2025) einmal stattfinden, sondern von nun an dauerhaft eingeplant werden – z. B. als fester Teil jeder Entwicklungsiteration oder mindestens als halbjährlicher Check aller wichtigen Funktionen[5]. Nur so kann Barrierefreiheit nachhaltig aufrechterhalten werden.
Interne Tester vs. externe Dienstleister
Unternehmen stehen vor der Frage, wer die Barrierefreiheits-Tests durchführen soll. Beide Ansätze – internes Personal oder externe Experten – haben Vor- und Nachteile:
- Interne Tester/Teams: Größere Unternehmen können erwägen, eigenes Know-how aufzubauen, indem sie Mitarbeiter zu Accessibility-Experten schulen oder neue Fachkräfte einstellen. Der Vorteil liegt in der direkten Integration ins Team: interne Tester kennen das Produkt, können früh im Entwicklungsprozess Feedback geben und fortlaufend die Seiten prüfen. Sie sind bei allen Relaunches und Content-Updates zur Stelle. Allerdings kostet es Zeit und Geld, interne Kräfte entsprechend auszubilden. Zudem muss das Wissen gepflegt werden (WCAG-Standards entwickeln sich weiter, z.B. WCAG 2.2 und 3.0 in Zukunft). Für viele KMU dürfte es sich nicht lohnen, eine Vollzeitstelle nur für Barrierefreiheit zu schaffen. Hier könnte man stattdessen jemanden im Team mit Teilzeitrolle als Accessibility-Beauftragten benennen und gezielt schulen.
- Externe Tester/Dienstleister: Spezialisierte Accessibility-Agenturen oder freiberufliche Experten bieten professionelle Audits und Tests an. Diese bringen meist umfangreiche Erfahrung mit und verfügen über Testpersonen mit Behinderungen für Nutzertests. Ein externer Audit liefert einen unabhängigen Blick und konkrete Verbesserungsberichte. Vorteil: externe Tester sehen „betriebsblindheit“ nicht, sie prüfen nach festem Standard und oft mit zertifiziertem Hintergrund (z. B. IAAP-Zertifikate wie CPACC oder WAS sind Qualitätsmerkmale[8]). Für kleine Unternehmen ist es häufig kosteneffizienter, periodisch externe Tests einzukaufen als selbst Personal vorzuhalten. Nachteil: Externe sehen das Produkt nur punktuell; zwischen den Prüfungen könnten neue Probleme entstehen. Außerdem muss man für Nachtests erneut beauftragen, wodurch laufende Kosten entstehen.
In der Praxis bietet sich oft eine Kombination an: z. B. initial ein großer Audit durch Externe, um alle Grundprobleme zu identifizieren und das Team zu sensibilisieren, dann regelmäßige kleinere Checks (einfachere Tests evtl. intern, umfangreichere wieder extern). Wichtig ist, dass Verantwortlichkeiten klar definiert sind – wer kümmert sich um Barrierefreiheit? Unser Rat: Unternehmen sollten explizit Verantwortliche benennen oder beauftragen, anstatt zu hoffen, dass Entwickler das „so nebenbei“ mitmachen. Dedizierte Tester (intern oder extern) sorgen für den nötigen Fokus und Professionalität.
Risiken bei fehlendem oder unzureichendem Testing
Ohne gründliches Testing läuft man Gefahr, dass die Website zwar auf dem Papier die WCAG-Kriterien erfüllen soll, aber in der Realität Barrieren bestehen bleiben. Fehlendes Testing kann zu folgenden Risiken führen:
- Rechtsverstöße und Abmahnungen: Selbst bei gutem Willen können ungetestete Webseiten versteckte Barrieren enthalten, die einen Verstoß gegen BFSG bedeuten. Wird dies von der Aufsichtsbehörde oder Wettbewerbern entdeckt, drohen rechtliche Schritte (siehe nächster Abschnitt). Ein Unternehmen kann sich nicht damit entschuldigen, von den Problemen „nichts gewusst“ zu haben – die Verantwortung liegt klar beim Anbieter, die Barrierefreiheit sicherzustellen. Ohne regelmäßige Tests ist die Gefahr groß, dass man unwissentlich nicht konform ist.
- Nutzerverlust und Imageschäden: Menschen mit Behinderungen, die auf Barrieren stoßen, werden im Zweifel abspringen und zur Konkurrenz gehen. Sie könnten ihre negativen Erfahrungen öffentlich machen, was dem Ruf schadet. Selbst Nutzer ohne Behinderung merken oft, wenn eine Seite z.B. schlecht navigierbar oder verwirrend aufgebaut ist – Barrierefreiheit hängt eng mit guter Benutzerfreundlichkeit zusammen[7]. Wer nicht testet, riskiert also eine schlechtere User Experience für alle Besucher.
- Technische Probleme: Manche Barrierefreiheitsmängel deuten auf tieferliegende technische Probleme hin (etwa falscher HTML-Code). Diese können auch unabhängig von Accessibility Fehler verursachen (z. B. Darstellungsprobleme in Browsern, schlechtere SEO-Indexierung). Regelmäßige Tests helfen, solche Qualitätsprobleme früh zu erkennen.
- Nachbesserungskosten: Je später Barrieren bemerkt werden, desto teurer ist ihre Behebung. Wenn erst nach dem Launch auffällt, dass z.B. das gesamte Navigationsmenü für Screenreader unbrauchbar ist, muss eventuell ein größerer Code-Umbau erfolgen. Durch Testing während der Entwicklung (Shift-Left-Prinzip) lassen sich teure Rückruder-Aktionen vermeiden. Ein Sprichwort in diesem Kontext: „Nachher kostet es immer mehr“ – frühe Tests sparen Kosten[9] [9].
Zusammengefasst: Fehlendes Testing kann für Unternehmen rechtlich und wirtschaftlich teuer werden. Die relativ geringen Aufwendungen für regelmäßige Prüfungen stehen in keinem Verhältnis zu den möglichen Folgen eines unentdeckten Verstoßes.
Arten von Testverfahren: manuell, automatisiert, Nutzertests
Es gibt verschiedene Testmethoden, die idealerweise kombiniert eingesetzt werden, um die Barrierefreiheit umfassend zu prüfen. Hier ein Überblick der gängigsten Verfahren und ihrer Eigenschaften:
| Testverfahren | Beschreibung und Stärken | Grenzen |
| Automatisierter Test | Einsatz von Tools, die den Code auf gängige Barriere-Probleme scannen (z. B. fehlende alt-Tags, falsche Überschriftenordnung, Kontrastwerte). Beispiele: WAVE, Google Lighthouse, axe[3]. Sehr effizient für einen schnellen Überblick, da sie ganze Seiten in Sekunden prüfen und Entwicklern gleich Problemstellen zeigen. | Erkennen nicht alle Barrieren. Viele WCAG-Kriterien (schlüssige Texte, sinnvolle Alternativtexte, Bedienbarkeit für Nutzer) kann ein Tool nicht beurteilen[3]. Außerdem neigen sie zu False Positives/Negatives – sie melden evtl. Probleme, die keine sind, und übersehen kontextspezifische Hindernisse. Automatische Tests decken ca. 20–50% der Kriterien ab. |
| Manuelle fachliche Prüfung | Ein geschulter Auditor prüft die Website Schritt für Schritt anhand der WCAG-Kriterien oder BITV-Test-Prüfschritte. Er nutzt dabei auch Hilfsmittel wie Screenreader (z. B. JAWS, NVDA) und testet Keyboard-Navigation, Formulare, etc. Vorteil: Gründlichkeit – ein Mensch kann beurteilen, ob z. B. ein Alternativtext wirklich passend ist, oder ob die Struktur der Seite verständlich wirkt. | Aufwendig – manuelle Audits brauchen Zeit und Expertise. Für größere Websites müssen repräsentative Seiten aller Typen geprüft werden (Startseite, Produktseite, Checkout usw.), was mehrere Tage dauern kann. Daher auch kostenintensiver. Außerdem ist das Ergebnis nur so gut wie der Prüfer – daher sollten möglichst zertifizierte Experten oder erfahrene Tester eingesetzt werden. |
| Nutzertest mit Menschen mit Behinderung | Man lässt echte Nutzer aus der Zielgruppe die Seite ausprobieren, idealerweise unter Anleitung (z. B. in einem Usability-Testsetting oder Remote-Testing). Etwa: ein blinder Nutzer versucht, ein Produkt zu bestellen, ein motorisch eingeschränkter Nutzer testet die Navigation nur mit Tastatur, ein sehbehinderter Mensch probiert verschiedene Kontrast-Einstellungen. Diese Tests zeigen direkt, wo Praxisprobleme liegen – oft äußern die Tester auch wertvolles Feedback, was technisch korrekt sein könnte, aber unpraktisch ist. | Diese Tests sind nicht formal für die WCAG-Konformität, sondern eher zur Ergänzung. Sie können individuelle Unterschiede haben (was ein Nutzer schwer findet, kommt ein anderer zurecht). Außerdem erfasst ein kurzer Nutzertest nie 100% aller Funktionen. Er dient als Realitätscheck, ersetzt aber kein Kriterium-basiertes Audit. Auch organisatorisch muss man solche Tests erst mal durchführen (Testpersonen finden, Szenarien definieren). |
Wie man sieht, haben die Methoden unterschiedliche Stärken. Empfohlen wird daher ein Mix: Automatisierte Tools als erstes Screening (z. B. als Teil der CI/CD-Pipeline bei Webentwicklungen), plus manuelle Audits durch Experten für die Feinbewertung, plus gelegentliche Nutzertests, um die tatsächliche Bedienbarkeit sicherzustellen[5]. Unternehmen können sich z. B. halbjährlich einen externen Audit leisten und zwischendurch intern mit Tools prüfen. Wichtig ist, die Erkenntnisse aus den Tests systematisch umzusetzen und die Barrierefreiheitserklärung entsprechend anzupassen, falls nötig[5].
Rechtliche Risiken bei Nichtbeachtung des BFSG
Die Nichteinhaltung der Barrierefreiheitsanforderungen ab 2025 ist kein Kavaliersdelikt – rechtlich drohen erhebliche Konsequenzen. Im Wesentlichen sind drei Ebenen relevant: behördliche Sanktionen (Bußgelder, Untersagung), Abmahnungen/Unterlassungsklagen sowie mögliche Schadensersatzansprüche.
Behördliche Kontrollen und Bußgelder
Die Umsetzung des BFSG wird in Deutschland von den zuständigen Marktüberwachungsbehörden der Bundesländer kontrolliert[2] [2]. Das Gesetz sieht ein gestuftes Verfahren vor: Stellt eine Behörde fest, dass ein Unternehmen die Barriereanforderungen nicht erfüllt (Nicht-Konformität), erhält der Anbieter zunächst eine Aufforderung zur Nachbesserung innerhalb einer bestimmten Frist[2]. Wird dieser Aufforderung nicht oder unzureichend Folge geleistet, kann die Behörde Zwangsmaßnahmen ergreifen. Dazu zählen insbesondere Bußgelder von bis zu 100.000 € je Verstoß[2]. Die Höchstgrenze ergibt sich aus § 37 BFSG und wurde bewusst empfindlich angesetzt, um dem Thema Nachdruck zu verleihen[3]. In gravierenden Fällen kann die Behörde sogar anordnen, dass das Unternehmen die betroffene digitale Dienstleistung nicht mehr bereitstellen darf, bis die Barrierefreiheit hergestellt ist[2]. Konkret könnte z. B. ein Online-Shop im Extremfall vorübergehend geschlossen werden, falls er trotz Aufforderung weiterhin unzugänglich bleibt[4]. Auch der Entzug von öffentlichen Fördermitteln ist denkbar, wenn Barrierefreiheit als Auflage missachtet wurde[5].
Unternehmen sollten diese Szenarien ernst nehmen. Die Behörden können entweder von sich aus tätig werden (proaktive Überwachung) oder aufgrund von Hinweisen Dritter (z. B. Beschwerden von Verbrauchern oder Behindertenverbänden) einschreiten[4]. Die Praxis zeigt, dass gerade Verbraucherzentralen und Behindertenverbände aufmerksam beobachten werden, ob große Anbieter ab 2025 ihre Pflichten erfüllen. Ein behördliches Verfahren mit Bußgeld kann nicht nur finanziell schmerzen, sondern zieht auch negative öffentliche Aufmerksamkeit nach sich.
Abmahnungen und Unterlassungsansprüche
Unabhängig von den Behörden eröffnet das BFSG auch die Bahn für zivilrechtliche Abmahnungen nach dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG). Die Anforderungen des BFSG an Online-Angebote werden aller Voraussicht nach als sogenannte Marktverhaltensregeln eingestuft[2]. Das bedeutet: Wenn ein Unternehmen diese Regeln verletzt (z. B. ein Online-Shop ist nicht barrierefrei, obwohl er es sein müsste), gilt dies zugleich als Verstoß gegen das UWG, der von Mitbewerbern oder berechtigten Institutionen abgemahnt werden kann[2]. Wettbewerber könnten argumentieren, ein nicht-barrierefreier Shop verschaffe sich einen unlauteren Vorteil, indem er gesetzliche Pflichten ignoriert. Auch Verbraucher- und Wettbewerbsverbände haben das Recht, solche Verstöße mit Unterlassungsklagen zu verfolgen[2]. Zudem nennt das BFSG ausdrücklich die Verbandsklagebefugnis von anerkannten Behindertenverbänden (§ 15 Abs. 3 BGG) – diese Organisationen können ebenfalls Unterlassungsklagen einreichen, um Barrierefreiheit durchzusetzen[2].
Praktisch bedeutet dies: Ab Mitte 2025 ist durchaus mit einer Welle von Abmahnungen zu rechnen[2]. Insbesondere größere E-Commerce-Seiten, die offensichtliche Mängel haben, könnten schnell im Visier stehen. Der Vorteil einer Abmahnung (aus Sicht der Abmahner) ist, dass sie schneller und niederschwelliger erfolgen kann als ein Behördenverfahren. Unternehmen erhalten dann ein Schreiben, in dem sie zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung aufgefordert werden – also versprechen müssen, die Barriere bis zu einem bestimmten Termin zu beseitigen, andernfalls wird eine Vertragsstrafe fällig.
Abmahnkosten: Normalerweise muss der Abgemahnte die Anwaltskosten des Abmahners tragen, was bei Massenabmahnungen zu einem Geschäftsmodell werden kann. Allerdings hat der Gesetzgeber gewisse Schranken eingezogen: Bei Verstößen gegen gesetzliche Informationspflichten im elektronischen Geschäftsverkehr – worunter auch eine fehlende Barrierefreiheitserklärung oder fehlende Hinweise fallen – besteht kein Kostenerstattungsanspruch des Abmahners nach § 13 Abs. 4 UWG[1]. Das dämpft zumindest das Abmahnrisiko in Bezug auf die Erklärung etwas, weil „Abmahnanwälte“ hier kein Geld verdienen können[1]. Dennoch bleibt ein Restrisiko, denn Abmahnungen können auch ohne Kostenfolge für den Abmahner verschickt werden, um den Konkurrenten zu schaden oder ihn unter Druck zu setzen. Zudem sind die wesentlichen Barrierepflichten (z. B. ein nicht barrierefreier Bestellprozess) nicht bloß Informationspflicht-Verstöße, sondern könnten voll abmahnfähig mit Kosten sein. Fazit: Unternehmen sollten davon ausgehen, dass Verstöße abmahnfähig sind und gegebenenfalls vor Gericht geklärt wird, wie einzelne BFSG-Vorgaben auszulegen sind[2].
Schadensersatz und weitere zivilrechtliche Folgen
Das BFSG selbst sieht primär öffentlich-rechtliche Sanktionen vor (Bußgeld, Untersagung) und ermöglicht wie beschrieben Unterlassungsansprüche. Schadensersatzansprüche von betroffenen Einzelpersonen sind im BFSG nicht ausdrücklich geregelt. Dennoch kann man sich Haftungsszenarien vorstellen: Wenn ein Mensch mit Behinderung aufgrund einer fehlenden Barrierefreiheit einen konkreten Nachteil erleidet, könnte er versuchen, z.B. auf Basis des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) oder deliktischer Haftung Schadenersatz geltend zu machen. Beispielsweise, wenn ein blinder Kunde im Online-Banking wegen Unzugänglichkeit eine Frist versäumt und dadurch finanziellen Schaden hat, könnte er den Anbieter in Haftung nehmen. Solche Fälle sind bisher kaum erprobt, aber Unternehmen sollten das Risiko kennen. Denkbar sind auch Gewinnabschöpfungsansprüche durch Verbraucherschutzverbände, falls ein Unternehmen bewusst gegen das Gesetz verstößt, um Kosten zu sparen – dann könnten nach UWG die erzielten Gewinne aus dem rechtswidrigen Verhalten abgeschöpft werden (das Instrument kommt selten zur Anwendung, ist aber im Raum).
Jenseits monetärer Ansprüche darf man Reputationsrisiken nicht vergessen: Ein bekanntes Unternehmen, das trotz gesetzlicher Lage seine digitalen Angebote nicht für alle zugänglich macht, könnte in den Medien und sozialen Netzwerken erheblichen Druck und Imageverluste erfahren. Das kann indirekt ebenfalls finanzielle Folgen haben (Kundenverlust, negatives Markenbild).
Zusammengefasst: Bei Nichtbeachtung des BFSG drohen Bußgelder bis 100.000 €, behördliche Nutzungsuntersagungen, wettbewerbsrechtliche Abmahnungen und Klagen[2] [2]. Diese Palette an Sanktionen ist bewusst scharf gewählt worden, um die private Wirtschaft zur Einhaltung zu bewegen. Darüber hinaus bestehen weiche Risiken wie Fördermittelverlust oder Reputationsschäden[5]. Kurz: Unternehmen, die ab 2025 Barrierefreiheit ignorieren, setzen sich erheblichen rechtlichen und geschäftlichen Gefahren aus.
Kostenfaktoren: Barrierefreies Redesign, Testing und Schulung
Die Umsetzung von Barrierefreiheit ist auch eine Kostenfrage, insbesondere für kleinere Unternehmen. Allerdings sind diese Kosten überschaubar im Vergleich zu den oben beschriebenen Strafzahlungen oder Umsatzeinbußen bei Ausschluss behinderter Kunden. Im Folgenden werden drei Hauptbereiche betrachtet, in denen Kosten entstehen können:
- das Redesign bzw. Nachrüsten bestehender Websites,
- die laufenden Tests (intern oder extern)
- sowie Beratung und Schulung von Mitarbeitern.
Barrierefreies Redesign bestehender Websites
Wenn bereits eine Website oder ein Online-Shop besteht, der noch nicht barrierefrei ist, stellt sich die Frage: Nachbessern oder komplett neu entwickeln? Die Kosten hängen stark vom Umfang und Zustand der Seite ab[8]. Oftmals ist es nicht nötig, alles neu zu machen – gezielte Anpassungen am bestehenden Code und Design können viele Barrieren beseitigen (Retrofit). Ein komplett neues barrierefreies Relaunch-Projekt kann jedoch sinnvoll sein, wenn die alte Seite technisch veraltet ist oder ein ohnehin fälliger Relaunch ansteht.
- Bei kleineren Websites (einfacher Aufbau, wenige Seiten) können die Kosten relativ gering bleiben. Hier reicht oft eine erste grobe Analyse durch einen Experten, um die größten Mängel festzustellen. So eine Analyse (~1 Personentag) kostet etwa 600 bis 1.200 Euro[8]. Darin werden noch keine Lösungen umgesetzt, aber man erhält einen Plan. Die eigentliche Umsetzung – z.B. Anpassung von Templates, Hinzufügen von Alternativtexten, Optimierung von Stylesheets – kann dann intern oder durch eine Agentur erfolgen. Für eine einfache Website ohne Shop bewegen sich die Gesamtkosten für den vollständigen Umbau nach Schätzung von Experten typischerweise im unteren vierstelligen Bereich (je nach Stundensatz und Aufwand vielleicht 2.000–5.000 €).
- Komplexe Websites oder Online-Shops haben naturgemäß mehr Aufwand. Hier sollten Unternehmen zunächst in einen umfassenden Accessibility-Test mit Report investieren, um alle Barrieren zu identifizieren. Ein professioneller Audit für einen mittelgroßen Webauftritt kostet ca. 2.500 bis 5.000 €[8]. Für sehr umfangreiche, komplexe Webshops kann ein Audit und Konzept auch 5.000 bis 10.000 € kosten[8]. Die anschließenden Entwicklungskosten, um die identifizierten Probleme zu beheben, kommen noch hinzu – je nach Anzahl der Templates und Tiefe der Probleme können das nochmals einige tausend Euro sein. In anspruchsvollen Fällen (großer Onlineshop mit individualisierter Oberfläche) kann ein barrierefreies Redesign auch im höheren fünfstelligen Bereich liegen, vor allem wenn man externe Agenturen mit spezieller Expertise beauftragt.
- Manche Unternehmen versuchen, mit sogenannten Overlay-Tools kurzfristig Barrieren zu überdecken (Plugins, die z.B. Schriftvergrößerung und Contrasteinstellung anbieten). Diese Tools (z. B. UserWay, AccessiBe) kosten meist eine monatliche Lizenzgebühr. Sie können einfache Verbesserungen bringen, ersetzen aber keine tiefe Anpassung und erfüllen oft nicht alle Anforderungen[9] [9]. Die Investition sollte eher in nachhaltige Lösungen fließen.
Kosten-Nutzen-Abwägung: Ein wichtiger Punkt ist, dass barrierefrei von Grund auf entwickeln nicht wesentlich teurer sein muss als ohne Barrierefreiheit, wenn man es von Anfang an einplant[8]. Das heißt, wenn ein Redesign ohnehin geplant ist, sollte Barrierefreiheit integraler Bestandteil sein – der Mehraufwand hält sich dann in Grenzen, weil man z.B. gleich die richtigen Markup-Techniken nutzt und nicht doppelt arbeiten muss. Nachträgliches Reparieren ist tendenziell teurer (es gilt: „Nachher kostet es immer mehr“[9]). Daher lohnen sich die Ausgaben jetzt, um später Kosten zu sparen. Zudem kann man ggf. Fördermittel für barrierefreie IT in Anspruch nehmen (einige staatliche Programme fördern die barrierefreie Umgestaltung, z. B. im Rahmen von Inklusionsförderungen – siehe Aktion Mensch Förderprogramm „Internet für Alle“).
Kosten für regelmäßige Tests (intern/extern)
Die Etablierung eines Testprozesses zieht ebenfalls laufende Kosten nach sich – jedoch variabel je nach gewähltem Modell:
- Externe Audits: Wie oben erwähnt, kostet ein ausführlicher Audit alle 1–2 Jahre je nach Größe der Website einige tausend Euro. Wenn ein Unternehmen z.B. jährlich einen externen Accessibility-Check für seinen Webshop beauftragt, könnte es mit ~3.000–6.000 € pro Jahr rechnen (Pi mal Daumen). Kleinere Follow-Up-Tests können günstiger sein, insbesondere wenn man mit dem gleichen Dienstleister wiederholt zusammenarbeitet (dann sind viele Grundthemen ja schon bekannt). Manche Agenturen bieten auch Service-Verträge an, z.B. quartalsweise Prüfungen im Paketpreis.
- Interne Testkapazitäten: Entscheidet man sich, einen Mitarbeiter (oder ein Team) intern mit Barrierefreiheits-Testing zu betrauen, entstehen Personalkosten. Ein Vollzeit-Accessibility-Experte (ggf. QA-Ingenieur mit Spezialisierung) dürfte – je nach Qualifikation – jährlich vielleicht 50.000 € und mehr kosten (Gehalt + Lohnnebenkosten). Für viele Mittelständler ist das zu hoch; daher eher Ansatz: einen vorhandenen QA/Tester mit dem Thema schulen (Kosten für Schulungen siehe unten) oder nur eine Teilzeitstelle dafür nutzen. Interne Tests haben den Vorteil, dass sie kontinuierlich laufen können und nicht für jeden Check extra gezahlt werden muss – die Kosten sind fix. Allerdings muss auch intern oft mit externen Hilfsmitteln gearbeitet werden (z.B. Screenreader-Lizenzen, Schulungstools), was kleinere Posten im Budget sind.
- Automatisierte Monitoring-Tools: Zusätzlich gibt es Tools wie Siteimprove oder Monsido, die gegen eine Abo-Gebühr (oft abhängig von der Website-Größe) kontinuierliches Monitoring von Barrierefreiheit und SEO anbieten[5]. So ein Tool kann z.B. monatlich Reports schicken, welche Accessibility-Fehler aufgetreten sind. Die Kosten liegen je nach Anbieter im mittleren drei- bis vierstelligen Bereich pro Jahr. Diese Tools ersetzen keinen menschlichen Test, können aber als Zwischenlösung nützlich sein, insbesondere für große Websites, um Probleme zeitnah zu erkennen.
- Nutzertests Budget: Falls man regelmäßig Usability-Tests mit behinderten Nutzern durchführen will, sollte man auch dafür Budget einplanen – z.B. Aufwandsentschädigungen für Tester, ggf. Agenturhonorare zur Organisation solcher Tests. Ein gezielter Nutzertest mit ~5 Personen könnte ein paar tausend Euro kosten. Viele machen das aber eher ad hoc bei großen Relaunches, nicht ständig.
Unterm Strich sollten Unternehmen für eine mittelgroße Website realistisch vielleicht jährlich einen niedrigen fünfstelligen Betrag (10.000–20.000 €) für Barrierefreiheits-Qualitätssicherung (Tests & Nachbesserungen) einplanen. Für kleinere Sites kann es auch deutlich weniger sein, für riesige Portale entsprechend mehr. Diese Summe ist als laufende Investition zu sehen, um gesetzeskonform und nutzerfreundlich zu bleiben – vergleichbar mit Wartungskosten, die ja ebenfalls regelmäßig anfallen.
Beratung und Schulungskosten
Gerade zu Beginn der Umstellung entstehen oft Kosten für externe Beratung oder Schulungen des eigenen Teams:
- Beratungsleistungen: Experten können punktuell hinzugezogen werden, um z.B. eine Initialberatung zu geben: „Was müssen wir in unserem konkreten Fall tun?“ Solche Beratertage kosten je nach Anbieter etwa 800–1.200 € pro Tag, ähnlich wie die Analyse-Tagespreise oben[8]. Häufig bieten Agenturen auch Pakete an – z.B. Workshop + Quick-Audit – um die Kunden handlungsfähig zu machen.
- Workshops und Schulungen: Die Sensibilisierung von Entwicklern, Designern und Redakteuren ist Gold wert. Dafür kann man interne Workshops veranstalten lassen. Ein ganztägiger Inhouse-Workshop zu digitaler Barrierefreiheit durch einen Profi kostet vielleicht 1.000–2.000 € (plus Reisekosten), abhängig von der Teilnehmerzahl und Vorbereitung. Auch Online-Schulungen werden angeboten, teils günstiger. Es gibt zudem Zertifikatskurse (z.B. IAAP-Schulungen für CPACC/WAS), die pro Person einige hundert bis tausend Euro kosten können. Diese Investitionen rechnen sich, weil geschulte Mitarbeiter später selbst Fehler vermeiden und intern weiter Wissen aufbauen.
- Dokumentation und Tools: Man sollte eventuell ein kleines Budget für Lehrmaterial (Bücher, Leitfäden) oder Testing-Tools Lizenzen einplanen. Viele Tools sind kostenlos, aber manche Profi-Werkzeuge (z.B. bestimmte Screenreader für Webentwicklung wie JAWS) sind kostenpflichtig. Das ist jedoch meist eine kleinere Ausgabe im Vergleich (JAWS Home Lizenzen z.B. einige hundert Euro).
Kostenvergleich intern vs. extern: Wenn man Berater nur bei Bedarf holt und ansonsten selbst macht, können die Anfangskosten moderat bleiben. Holt man sich eine Agentur, die „alles aus einer Hand“ erledigt (Audit, Umsetzung, Testing), zahlt man mehr, hat aber weniger Eigenaufwand. Jedes Unternehmen muss hier den für sich passenden Weg finden. Wichtig ist, nicht am falschen Ende zu sparen: Eine initiale Beratung und Schulung verhindert teure Fehlentwicklungen. Ebenso ist es besser, ein paar tausend Euro ins Testing zu stecken, als später hohe Bußgelder oder Rechtsstreitkosten tragen zu müssen.
Handlungsempfehlung: Barrierefreiheit strategisch angehen – Tester einbinden
Abschließend lässt sich als Handlungsempfehlung formulieren: Unternehmen sollten proaktiv und strategisch an das Thema Barrierefreiheit herangehen, anstatt nur reaktiv das Nötigste zu tun. Konkret heißt das: Dedizierte Tester oder Prüf-Verantwortliche einplanen, sei es durch Einstellung interner Experten oder durch feste Zusammenarbeit mit externen Testern.
Warum dieser Fokus auf Tester? Weil Barrierefreiheit eine Spezialdisziplin ist – ähnlich wie Sicherheit oder Datenschutz – die fortlaufende Aufmerksamkeit erfordert. Nur mit qualifizierten Tests kann ein Unternehmen sicher sein, dass seine Webseite nicht nur theoretisch den Anforderungen genügt, sondern auch praktisch für die Zielgruppen funktioniert. Ein Entwickler alleine, der vielleicht die WCAG-Liste nebenbei abarbeitet, wird erfahrungsgemäß nicht alle Gebrauchshürden erkennen. Externe oder interne Spezialtester bringen das nötige Know-how und die richtige Perspektive mit (oft auch die der Betroffenen selbst).
Praxisnah begründet: Stellen Sie sich einen Online-Shop vor, der formal alle WCAG-Checkpunkte abzuhaken versucht. Ohne einen sehbehinderten Tester hätte man vielleicht nie bemerkt, dass die Reihenfolge der Produktinfos auf Mobilgeräten verwirrend ist. Oder ohne einen blinden Tester fällt nicht auf, dass eine spezielle Filterfunktion mit Screenreader nicht bedienbar ist. Solche echten Szenarien offenbaren Tester in der Praxis sofort – und man kann sie beheben, bevor Kunden abspringen oder eine Abmahnung ins Haus flattert.
Außerdem signalisiert ein Unternehmen durch das Engagement von (internen oder externen) Test-Profis, dass es das Thema ernst nimmt. Das kann intern motivierend wirken (Barrierefreiheit bekommt Gewicht im Projektplan) und extern ggf. mildernd, falls doch mal ein Verstoß diskutiert wird („wir haben eigene Tester, es war keine Absicht, wir korrigieren sofort“).
Empfehlungsschritte:
- 1. Zuständigkeit festlegen: Bestimmen Sie einen Barrierefreiheits-Verantwortlichen. Das kann eine Person oder ein Team sein. Diese koordinieren alle Maßnahmen, verfolgen Gesetzesänderungen und sind Ansprechpartner (auch nach außen, z.B. für Verbände oder Beschwerden).
- 2. Externe Hilfe nutzen: Scheuen Sie nicht, zu Anfang externe Spezialisten hinzuzuziehen – sei es für ein Audit oder als laufende Berater. Beispielsweise könnte man einen Servicevertrag mit einer Accessibility-Agentur abschließen, die vierteljährlich Tests durchführt und beim Beheben hilft. So haben Sie geprüfte Qualitätssicherung, ohne intern alles können zu müssen.
- 3. Internes Know-how aufbauen: Parallel sollte zumindest ein Mitarbeiter geschult werden (z.B. ein QA-Ingenieur oder Entwickler mit Interesse am Thema). Dieser kann viele Dinge selbst vorab testen (auch mit kostenlosen Tools und Screenreader-Übungen) und eine Brücke bilden zwischen externen Experten und dem Entwicklungsteam. Im Idealfall wächst daraus langfristig ein internes Accessibility-Team. Für kleinere Betriebe reicht vielleicht ein externer Partner plus ein interner „Kümmerer“.
- 4. Testing fest im Entwicklungsprozess verankern: Barrierefreiheitstests sollten integraler Bestandteil jedes Releases oder Website-Projekts sein, nicht eine einmalige Extra-Aktion. Zum Beispiel: Jede neue Funktion wird auf Tastaturbedienung geprüft, jedes neue Video auf Untertitel. Vor Launch größerer Änderungen sollte ein finaler Check durch die Tester erfolgen (Freigabekriterium). Auch Content-Änderungen (neue PDF hochladen etc.) können in Redaktionsrichtlinien mit „Barrierefreiheits-Check“ versehen werden.
- 5. Feedback nutzen: Machen Sie es Nutzern leicht, Barrieren zu melden (die BFSG-Erklärung fordert das ohnehin)[4]. Wenn eine Rückmeldung kommt, reagieren Sie schnell – möglicherweise hat Ihr eigener Test etwas übersehen. So wird der Kreis zum Realnutzer geschlossen.
Indem Unternehmen Tester einstellen oder beauftragen, investieren sie in die Qualität und Rechtssicherheit ihres Online-Angebots. Es verhindert nicht nur Sanktionen, sondern erschließt auch neue Kundengruppen: Menschen mit Behinderungen verfügen in Deutschland über eine erhebliche Kaufkraft – sie und ihr Umfeld werden die barrierefreien Angebote bevorzugen. Zusätzlich profitieren alle User von einer zugänglicheren, benutzerfreundlichen Website[7]. Der Aufwand lohnt sich also betriebswirtschaftlich.
Zusammenfassend: Das BFSG mag zunächst wie eine weitere Compliance-Pflicht wirken, sollte aber als Chance gesehen werden, die eigene Website auf den neuesten Stand in Sachen User Experience zu bringen. Wer jetzt konsequent handelt, Tester einbindet und Barrierefreiheit zur Chefsache macht, verwandelt ein gesetzliches Muss in einen Wettbewerbsvorteil – durch inklusiven Service, der für alle Kunden erreichbar ist. Jetzt aktiv werden schützt vor rechtlichen Problemen ab 2025 und positioniert Ihr Unternehmen als fortschrittlich und verantwortungsbewusst in der digitalen Gesellschaft[5] [7].
Literaturverzeichnis:
[1] datenschutz-generator.de. (n.d.). Retrieved from https://datenschutz-generator.de/bfsg-ratgeber/
[2] haerting.de. (n.d.). Retrieved from https://haerting.de/wissen/das-barrierefreiheitsstaerkungsgesetz-bfsg-im-e-commerce/
[3] ra-plutte.de. (n.d.). Retrieved from https://www.ra-plutte.de/barrierefreiheitsstaerkungsgesetz/
[4] aktion-mensch.de. (n.d.). Retrieved from https://www.aktion-mensch.de/inklusion/barrierefreiheit/barrierefreie-website/gesetzliche-pflichten
[5] ionos.de. (n.d.). Retrieved from https://www.ionos.de/digitalguide/websites/web-entwicklung/barrierefreiheitsstaerkungsgesetz/
[6] bundesfachstelle-barrierefreiheit.de. (n.d.). Retrieved from https://www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/DE/Fachwissen/Produkte-und-Dienstleistungen/Barrierefreiheitsstaerkungsgesetz/barrierefreiheitsstaerkungsgesetz_node.html
[7] eye-able.com. (n.d.). Retrieved from https://eye-able.com/de/bitv-barrierefreiheit
[8] aktion-mensch.de. (n.d.). Retrieved from https://www.aktion-mensch.de/inklusion/barrierefreiheit/barrierefreie-website/kosten-barrierefreie-website
[9] lechatinformatique.de. (n.d.). Retrieved from https://lechatinformatique.de/barrierefreiheit-auf-websites-kosten-und-nutzen/